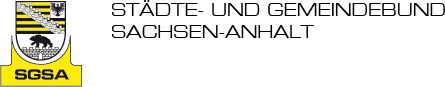Bundestag beschließt „Starke-Familien-Gesetz“

Der Bundestag hat am 21.03.2019 das Starke-Familien-Gesetz verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist, Familien mit kleinen und mittleren Einkommen wirksamer vor Armut zu schützen, den Bedarf von Kindern zu sichern und dafür zu sorgen, dass sich auch bei kleinen Einkommen Erwerbstätigkeit lohnt. Dazu werden der Kinderzuschlag erhöht und neugestaltet sowie die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets verbessert.
Beim reformierten Kinderzuschlag sind künftig rund zwei Millionen Kinder anspruchsberechtigt. Bislang waren es nur ca. 800.000 Kinder. Für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket werden künftig rund vier Millionen Kinder anspruchsberechtigt sein. Für die Reform des Kinderzuschlags ist bis Ende 2021 eine Milliarde Euro eingeplant. Die Verbesserungen im Bildungs- und Teilhabepaket kosten nach Berechnungen des Bundesministeriums rund 220 Mio. Euro pro Jahr.
Der Kinderzuschlag ist seit 01.01.2005 eine Familienleistung, der die Familien im Niedrigeinkommensbereich spürbar entlasten und Kinderarmut von unter 25 Jahre alten Kindern und Jugendlichen bekämpften soll. Der Kinderzuschlag wird an Eltern für das in ihrem Haushalt lebende Kind gezahlt, wenn sie mit ihrem Einkommen zwar den eigenen Bedarf decken können, nicht aber den ihrer Kinder. Der Kinderzuschlag muss schriftlich bei der örtlich zuständigen Familienkasse beantragt werden. Finanziert wird der Kinderzuschlag aus Bundesmittel.
Die verabschiedete Neugestaltung des Kinderzuschlags erfolgt in zwei Schritten:
Zum 1. Juli 2019 wird der Kinderzuschlag von derzeit maximal 170 Euro auf 185 Euro pro Monat und Kind erhöht: Damit sichert der Kinderzuschlag zusammen mit dem Kindergeld und den gesondert gewährten Bildungs- und Teilhabeleistungen die Existenzgrundlage der Kinder. Ab 2021 wird die Höhe entsprechend des Existenzminimumberichts dynamisiert. Kindeseinkommen (z. B. Unterhaltszahlungen) soll den Kinderzuschlag nur noch zu 45 Prozent mindern, statt wie bisher zu 100 Prozent. Damit wird der Kinderzuschlag für Alleinerziehende geöffnet, auch wenn die Kinder Unterhaltszahlungen oder -vorschuss erhalten. Damit die Leistung dort ankommt, wo sie gebraucht wird, wird der Antragsaufwand für Familien deutlich einfacher. So wird die Leistung in Zukunft für sechs Monate gewährt und nicht mehr rückwirkend überprüft. Damit müssen Familien auch nicht mehr zwischen Kinderzuschlag und Grundsicherung hin- und herwechseln, wenn ihr Einkommen etwas schwankt.
Zum 1. Januar 2020 wird die „Abbruchkante“, an der der Kinderzuschlag bislang schlagartig entfällt, abgeschafft. Dazu werden die oberen Einkommensgrenzen aufgehoben. Nach bisheriger Rechtslage konnte es passieren, dass Familien im Kinderzuschlag nur ein wenig mehr Geld verdienen und dadurch der Kinderzuschlag komplett wegfällt, so dass sie insgesamt weniger Geld zur Verfügung haben als zuvor. Ab dem nächsten Jahr läuft die Leistung kontinuierlich aus, so dass negative Erwerbsanreize vermieden werden. Zusätzliches Einkommen der Eltern soll den Gesamtkinderzuschlag nur noch zu 45 Prozent mindern, statt wie bisher zu 50 Prozent. Wenn das Einkommen der Eltern steigt, läuft die Leistung langsamer aus und der Familie bleibt damit mehr vom Kinderzuschlag.
Familien sollen auch dann den Kinderzuschlag erhalten können, wenn sie bisher kein SGB II beziehen und ihnen mit ihrem Erwerbseinkommen, dem Kinderzuschlag und gegebenenfalls dem Wohngeld höchstens 100 Euro fehlen, um Hilfebedürftigkeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zu vermeiden. Dieser erweiterte Zugang zum Kinderzuschlag für Familien, die in verdeckter Armut leben, wird allerdings zunächst auf drei Jahre befristet.
Zusätzlich wird zum 1. August 2019 das sog. Bildungs- und Teilhabepaket verbessert: Das Schulstarterpaket steigt von 100 Euro auf 150 Euro und in den Folgejahren entsprechend der Steigerung der Regelsätze. Die monatliche Teilhabeleistung steigt von 10 Euro auf pauschal 15 Euro. Die Eigenanteile der Eltern für das gemeinsame Mittagessen in Kita und Schule sowie für die Schülerfahrkarte fallen weg. Mit dieser Maßnahme werden die Eltern nicht nur finanziell entlastet, sondern es fällt auch eine Menge Bürokratieaufwand für Eltern, Dienstleister und Verwaltung weg. Darüber hinaus kann eine Lernförderung auch beansprucht werden, wenn die Versetzung nicht unmittelbar gefährdet ist.
Das Starke-Familien-Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats
Anmerkung:
Grundsätzlich wird der Ausbau des Kinderzuschlags zu einem den Sozialgesetzbüchern II und XII vorgelagerten Sicherungssystems begrüßt. Zu kritisieren ist, dass durch das komplizierte Antragsverfahren, die aufwendige Einkommensprüfung und die starren Einkommensgrenzen nur wenige anspruchsberechtigte Familien den Kinderzuschlag überhaupt erhalten. Das mit dem Starke-Familien-Gesetz verfolgte Ziel einer Entbürokratisierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen wird ebenfalls begrüßt. Die Änderungen beim Kinderzuschlag sowie bei den Bedarfen für Bildung und Teilhabe werden einen notwendigen Beitrag dazu leisten, diese Leistungen wirksamer auszugestalten und in gewissem Maße Verwaltungsvereinfachungen zu realisieren.
Die Erweiterung des Personenkreises beim Kinderzuschlag hat allerdings auch unmittelbare Auswirkungen auf das zum 01.01.2019 in Kraft getretene Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Der Bund prognostizierte schon im damaligen Gesetzgebungsverfahren kommunale Einnahmeausfälle durch die Befreiung von Elternbeiträgen aufgrund der neuen Beitragsregelungen in Höhe von mindestens 150 Mio. Euro. Wir erwarten, dass die Einnahmeverluste durch die Länder im Rahmen der Konnexitätsregelungen ausgeglichen werden.