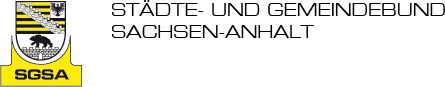Krankenhäuser: Wichtige Standortfaktoren für die Regionen

Die Corona-Pandemie trifft in Deutschland auf eine Debatte über die Zukunft der Krankenhauslandschaft. Dabei geht es um die Frage, ob es nicht zu viele kleine Krankenhäuser gibt und es klüger wäre, die Ressourcen in größeren Krankenhauszentren zu bündeln. Im vergangenen Jahr spitzte die Bertelsmann-Stiftung diese Debatte mit einer Studie zu, nach der eine „bessere Versorgung“ mit weniger kleineren Krankenhäusern in der Fläche möglich sei. Ginge es nach den Autoren der Studie würden weniger als 600 Krankenhäuser ausreichen und es dürfte keine Klinik unter 200 Betten geben. Die Corona-Pandemie verdeutlicht, wie wichtig die flächendeckende Präsenz von Krankenhäusern gerade in ländlichen Regionen zur Sicherstellung der Grundversorgung ist.
Tatsächlich gibt es in Deutschland schon seit Jahren Bestrebungen, die Zahl der Krankenhäuser zu reduzieren. In der Corona-Krise spricht aber vieles dafür, dass die Patienten von der hohen Dichte an Krankenhäusern und Intensivbetten enorm profitieren. Auf 100.000 Einwohner kommen hierzulande 33,9 Intensivbetten, das ist mehr als in den meisten anderen Ländern auf der Welt. Den umfassendsten internationalen Vergleich hat kürzlich die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vorgelegt: Im Durchschnitt der zehn untersuchten Länder standen 15,9 Intensivbetten je 100.000 Einwohner zur Verfügung, also nicht einmal halb so viele wie in Deutschland. Danach folgt Österreich mit 28,9 Betten, Frankreich lag mit 16,3 etwas abgeschlagen, aber immer noch über dem Durchschnitt. In Spanien und Italien gibt es nur 9,7 beziehungsweise 8,6 Betten, entsprechend hoch war dort die Sterblichkeit; sie lag bei neun beziehungsweise zwölf Prozent.
Noch schlechter schnitten, was die Ausstattung mit Intensivbetten betrifft, nur Dänemark mit 7,8 und Irland mit fünf Betten ab. Gerade Dänemark wurde im Zusammenhang mit Schließungsdiskussion immer wieder als Beispiel genannt. Das Institut für Gesundheitsökonomie des Helmholtz-Zentrums hält unter anderem die Vernetzung der Kliniken für einen Grund, weshalb die Bundesrepublik bisher sicher durch die Pandemie steuerte. So gibt es ein zentrales Register, in das die einzelnen Krankenhäuser die Zahl der freien Intensivbetten eintragen. Derzeit meldet das Register knapp 10.000 freie Betten auf Intensivstationen. Die ungenutzten Kapazitäten sind groß genug, so dass Deutschland sogar Patienten aus anderen europäischen Ländern aufnehmen kann.
In Deutschland ist die Zahl der Infizierten zwar recht hoch, doch die Krankenhäuser scheinen die Lage im Griff zu haben. Die Sterberate unter den bestätigten Corona-Infizierten in Deutschland liegt bei 2,7 Prozent (Stand 16. April). Sie ist um ein Vielfaches niedriger als beispielsweise in Italien, Spanien oder Großbritannien, wo der Anteil der Covid-19-Toten jeweils bei deutlich über zehn Prozent liegt.
Im Übrigen nehmen auch kleinere Häuser weiter an der Versorgung der Patienten teil. Wenn diese wegfallen würden, hätten die größeren Zentren deutlich mehr Patienten, die sie irgendwann nicht mehr bewältigen könnten. Hinzu kommt, dass die Intensivstationen der kleinen Krankenhäuser im Mittel deutlich weniger ausgelastet sind als die der großen Maximalversorger – die Auslastung der Intensivbetten steigt nämlich laut Statistischem Bundesamt mit zunehmender Größe des Krankenhauses. Im Durchschnitt waren die Intensivstationen zu knapp 79 Prozent ausgelastet, in sehr großen Häusern mit 800 Betten und mehr lag der Auslastungsgrad bereits bei etwa 83 Prozent. Umgekehrt war in kleinen Krankenhäusern mit höchstens 50 Betten im Mittel nicht einmal jedes zweite Intensivbett belegt, bei Häusern der Größe zwischen 100 und 150 Betten lag die Quote bei zwei Dritteln. Auch die kleineren Häuser leisten somit einen maßgeblichen Anteil an der Versorgung von Corona-Patienten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts entfallen 14 Prozent aller Betten auf den Intensivstationen auf jene 840 Krankenhäuser, die jeweils weniger als 200 Betten haben und darum nach Auffassung der Bertelsmann-Stiftung geschlossen gehören.
Allerdings gehört das bisherige Finanzierungssystem auf den Prüfstand. Die Krankenpflege ist bereits nicht mehr den üblichen Fallpauschalen unterworfen. Aber die Fallpauschale gehört insgesamt nachjustiert, gerade für die Krankenhäuser der Grundversorgung in der Fläche.
Darüber hinaus sollte statt der Schließung über die Umwandlung in ambulant-stationäre Zentren nachgedacht werden. Dies setzt aber voraus, dass man sich endlich über die sektorenübergreifende Versorgung unter Einbeziehung der pflegerischen Versorgung verständigt.