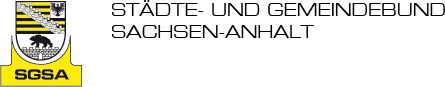Studie zur kommunalen Förderlandschaft

Am 02.12.2021 hat die „PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH“ eine in Kooperation mit dem Deutschen Städtetag erstellte Analyse der kommunalen Förderlandschaft veröffentlicht. Gefördert wurde die Studie vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Rahmen des Investitionsberatungsauftrags (IBA). Die Ergebnisse fußen auf einer Umfrage unter 319 Fördernehmenden aus 96 Kommunen und 27 Fördergebenden. Die meisten Förderprogrammerfahrungen stammen bei Nehmern und Gebern jeweils aus den Bereichen Städtebau sowie Mobilität und ÖPNV.
Die Studie hat nochmals unterstrichen, dass die Vielzahl kommunaler Förderprogramme von zudem unterschiedlichen Förderstellen für die Kommunen nur schwer händelbar ist. Die Förderdatenbank des Bundes, die neben Bundesprogrammen Programme der Länder, der EU sowie sonstiger Förderstellen und Projektträger umfasst, weist aktuell 2.600 Programme auf, wovon 900 für die Kommunen bestimmt sind.
Folge ist, dass eigentlich dringend benötigte Fördermittel nicht abgerufen werden können. 60 Prozent der im Zuge der Studie befragten Kommunen gaben an, auf die Beantragung verfügbarer Fördermittel verzichtet zu haben. Die Hemmnisse für die Inanspruchnahme der Fördermittel sind mannigfaltig und letztlich bekannt. Neben den begrenzten Personalressourcen sind hierzu fehlende Erfahrung mit Fördermitteln, hohe Förderprogrammanzahl, komplizierte Antragsverfahren, zu kurze Programmlaufzeiten, ein zu hoher Eigenanteil und eine zeitintensive Umsetzung (Dokumentationsaufwand etc.) zu zählen.
Auf Basis der Ergebnisse der Befragung haben die Autoren der Studie einen 8-Punkte-Plan für erfolgreiche Förderprogramme abgeleitet:
- Einheitliche Systematik der Förderrichtlinien
- Ausrichtung des Förderprogramms an Bedarf und Umsetzungsmöglichkeiten der Fördernehmenden
- Förderprogramm hat einen eindeutigen Förderzweck, Bündelung ähnlicher Programme
- Zentrale Informationsplattform zu Förderprogrammen
- Zentrale und spezialisierte Anlaufstelle zum Erfahrungsaustausch und Unterstützung bei Antragsstellung bzw. Abwicklung
- Förderprogramm muss sich am Ergebnis orientieren, Handlungsspielraum für verschiedene Umsetzungsvarianten gegeben sein
- Bei Antrags- und Nachweispflichten Grundsatz: „So viel wie nötig und so wenig wie möglich“
- Eigenanteil muss Fördernehmenden vollumfänglich bekannt sein, Verringerung Eigenanteil bei Strukturschwäche bzw. Ermöglichung alternativer Finanzierung des Eigenanteils
Anmerkung:
Die aktuelle Studie unterstreicht nochmals, dass die zunehmende Atomisierung der Förderprogramme ein großes Hemmnis für deren Inanspruchnahme ist. Gleiches gilt unter anderem auch für den personellen und administrativen Aufwand sowie den zu erbringenden Eigenanteil. All dies sind keine neuen Erkenntnisse. Vor allem finanzschwache und kleine Kommunen werden dadurch in ihrer Annahmefähigkeit von Fördermitteln benachteiligt. Eine Alternative wären sog. Investitions- bzw. Infrastrukturpauschalen. Das Präsidium des Deutschen Städte- und Gemeindebundes hat in seiner 141. Sitzung am 15./16.11.2021 in Bonn hierzu folgenden Beschluss gefasst:
„Überkomplexe und komplizierte Förderprogramme statt pauschalierter Zuweisungen überfordern die Verwaltungskraft von Städten und Gemeinden und benachteiligten deren Annahmefähigkeit für die Fördermittel. Das Präsidium fordert, dass diese zielgenau gewährt werden und die kommunale Investitionsfähigkeit über die Förderung mit Infrastrukturpauschalen gestärkt wird.“
Solche Infrastrukturpauschalen würden damit auch einen wichtigen Beitrag zur Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse leisten. Denn mit Blick auf die Förderlandschaft muss ansonsten allgemein festgehalten werden, dass die Vielfalt und Komplexität des Fördersystems sowie die notwendigen Eigenanteile bislang dafür sorgen, dass insbesondere leistungsstarke Kommunen an den Förderprogrammen partizipieren. Die Inanspruchnahme der Fördermittel darf aber eben nicht an der Leistungsfähigkeit und Haushaltslage einzelner Städte und Gemeinden scheitern.
Zudem finden sich unter anderem im Mobilitätsbereich ähnliche Förderinhalte bei mehreren Bundesministerien. Hier ist im Sinne der Übersichtlichkeit eine Harmonisierung angezeigt. Klar ist auch, dass Fördermittel keinen Ersatz für eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen darstellen können. Deshalb ist es zunächst ein gutes Signal, dass die Regierungskoalition auf Bundesebene die Altschuldenproblematik der Kommunen gemeinsam mit den Ländern nachhaltig lösen möchte und dies auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat. Wichtig ist zudem das Vorhaben der Koalition, bei finanzschwachen Kommunen die Eigenanteile zu reduzieren oder durch andere Leistungen zu ersetzen. Bei der Neuausrichtung der Programme sollte jetzt ermöglicht werden, dass der kommunale Eigenanteil auch durch Personal- und Sachleistungen erbracht werden kann. Nicht abgerufene Fördermittel will die Koalition weiter zweckgebunden für Förderungen der Kommunen zur Verfügung stellen, was einer kommunalen Forderung nach einer langfristigen Förderung der Kommunen entspricht. Insgesamt erwarten wir von der neuen Bundesregierung nun eine stärkere ressortübergreifende Zusammenarbeit und Bündelung der Programme auf Bundesebene, einheitliche und einfachere Antragsverfahren sowie gute Beratungsangebote für die Kommunen.
Weitere Informationen
Studie PD-Perspektiven: „Analyse der kommunalen Förderlandschaft“: www.pd-g.de
PD-Flyer „8-Punkte-Plan“: www.pd-g.de