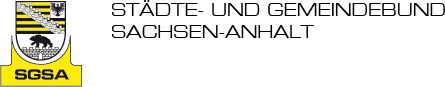Fünf Prozent weniger Waldfläche in drei Jahren

Die Waldverluste in Deutschland sind nach einer Mitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) vom 21.02.2022 erheblich höher als bisher angenommen. Die Forscher des DLR machten zum ersten Mal anhand von Satellitenaufnahmen deutschlandweit sichtbar, wie viel Baumbestand verloren gegangen ist. Die Ergebnisse sind alarmierend: Von Januar 2018 bis einschließlich April 2021 seien in Deutschland auf rund 501.000 Hektar Fläche Baumverluste zu verzeichnen. Der Verlust entspreche fast fünf Prozent der gesamten Waldfläche und sei damit erheblich höher als bisher angenommen. Als Auslöser gelten "vor allem die ungewöhnlich starken Hitze- und Dürreperioden in diesen Jahren, die wiederum den Befall durch Schadinsekten begünstigt haben, teilt das DLR zur Auswertung mit.
Der Blick aus dem All zeige, dass überwiegend die Mitte Deutschlands mit ihren Nadelwäldern betroffen ist – von der Eifel, über Sauerland, Harz und Thüringer Wald, bis in die Sächsische Schweiz. Allein Nordrhein-Westfalen habe innerhalb von drei Jahren mehr als ein Viertel seiner Fichtenwälder verloren, in einigen Landkreisen seien es sogar mehr als zwei Drittel. Die Bäume seien abgestorben oder großflächigen Notfällungen zum Opfer gefallen. „Kahlschläge sind oft die letzte Maßnahme bei massivem Schädlingsbefall, um – im Fall von Fichten – dem Borkenkäfer die Nahrung zu entziehen und dadurch seine weitere Ausbreitung zu verhindern“, so das DLR.
Während sich Laubbäume wie die Eiche nach einem Insektenbefall wieder erholen könnten, gelte dies häufig nicht für Nadelbäume. Nach dem Zweiten Weltkrieg seien in Deutschland vorrangig Fichten als wichtigster Holzlieferant aufgeforstet worden, nicht selten standortfremd. Diese Wälder wiesen eine entsprechend ähnliche Alters- und Wuchsstruktur auf und seien als Monokultur weniger widerstandsfähig. Zwischen 2018 und 2020 wurde ganz Mitteleuropa von mehreren ungewöhnlich starken Dürre- und Hitzeperioden heimgesucht. Dies habe die grünen Riesen geschwächt – die Defizite in der Bodenfeuchte seien bis heute messbar. Gleichzeitig habe die trockene Hitze ideale Bedingungen für den Borkenkäfer geschaffen, sodass sich die Populationen explosionsartig vermehrten. [mehr]