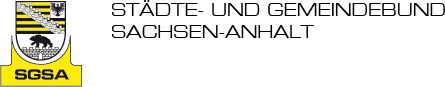Analyse der Grundsteuerhebesätze in Deutschland von 2005 – 2023

Zuletzt hatten wir über die von Ernst und Young (EY) veröffentlichte Studie zur Entwicklung der Grundsteuerhebesätze in Deutschland für den Zeitraum von 2005 – 2022 berichtet. Im November 2024 hat Ernst und Young erneut eine Analyse zur Entwicklung der Grundsteuer B von 2005 – 2023 veröffentlicht. Die Studie basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes zu den Realsteuerhebesätzen; Stichtag ist jeweils der 31. Dezember. Anders als in den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes handelt es sich bei den angegebenen Durchschnittshebesätzen der Bundesländer nicht um gewichtete Werte, sondern um den Durchschnittswert aller Gemeinden unabhängig von der Einwohnerzahl.
Nachdem Ernst und Young die Ergebnisse der Analyse bereits im vergangenen Jahr dahingehend kommentierte, dass sie den stärksten Anstieg der Grundsteuer B seit sechs Jahren zeigen, ist laut aktueller Pressemitteilung von Ernst und Young die Grundsteuer B im vergangenen Jahr mit 18 Prozentpunkte von 391 auf 409 % so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht. 25 % aller deutschen Kommunen haben demnach im Jahr 2023 ihren Grundsteuerhebesatz angehobenen. Im Vorjahr lag der Anteil laut Pressemitteilung bei 13 %, ein Jahr zuvor bei 8 %.
Im vergangenen Jahr beschlossen 2.671 der knapp 10.800 deutschen Kommunen eine Hebesatzerhöhung. Finanziell in der Lage ihren Hebesatz herabzusetzen waren hingegen nur 49 Städte und Gemeinden. Vor allem in Rheinland-Pfalz waren die Kommunen fiskalisch gezwungen, ihren Hebesatz zu erhöhen (79 Prozent), da eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs in Kraft trat und in diesem Zuge der sog. Nivellierungshebesatz bei der Grundsteuer B merklich erhöht wurde. In Nordrhein-Westfalen waren es 28 Prozent und in Niedersachsen 21 Prozent der Kommunen.
Am höchsten waren die Hebesätze im Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen mit 577 Prozentpunkten (+13), gefolgt von Hessen (507 Prozentpunkte, +12) und Rheinland-Pfalz (464 Prozentpunkte, +69). Vor diesem Hintergrund verwundert es auch nicht, dass von den 50 deutschen Kommunen mit den höchsten Hebesätzen 28 in Nordrhein-Westfalen, 21 in Hessen und eine in Rheinland-Pfalz liegt. Am niedrigsten waren die durchschnittlichen Hebesätze in Schleswig-Holstein (348 Prozentpunkte, +1) und Bayern (355 Prozentpunkte, +2).
Der Pressemitteilung von Ernst und Young ist allerdings auch zu entnehmen, dass es Bundesländer gab, in denen die Erhöhungsdynamik zurückgeht, so etwa im Saarland und in Baden-Württemberg. In einigen Bundesländern würden die meisten Städte und Gemeinden schon seit Jahren darauf verzichten, ihre Hebesätze zu erhöhen. Hierzu gehört neben Thüringen, Bayern und Sachsen auch Sachsen-Anhalt, wo die Steigerungsrate bei 5 % liegt. Dieser Trend hält im Übrigen in Sachsen-Anhalt auch im Jahr 2024 an. Lediglich 11 Städte und Gemeinden änderten im ersten Halbjahr 2024 ihre Hebesätze für die Grundsteuer B.
Hebesatzentwicklung Zeitraum 2005 bis 2023
Im Zeitraum 2018 bis 2023 haben gut 48 Prozent der Städte und Gemeinden ihren Grundsteuer B Hebesatz erhöht, während nur 1 Prozent diesen abgesenkt haben.
Während im Jahr 2005 nur 5 Prozent der Kommunen einen Grundsteuer B Hebesatz von über 400 Prozentpunkten hatten, waren es im vergangenen Jahr schon 53 Prozent. Gegensätzlich ist die Entwicklung bei Kommunen mit einem niedrigen Hebesatz unter 300 Prozentpunkten von 22 Prozent im Jahr 2005 auf nunmehr 3 Prozent.
Anmerkung:
Medial hat die EY-Analyse vor allem vor dem Hintergrund der Reform der Grundsteuer und der vom damaligen Bundesfinanzminister Olaf Scholz versprochenen Aufkommensneutralität die Runde gemacht, nach dem Motto, die Kommunen erhöhen jetzt kräftig, damit sie dann Aufkommensneutralität proklamieren können.
Ein tieferer Blick in die Zahlen stützt diese These jedoch nicht. EY weist zurecht darauf hin, dass der besonders starke Anstieg im Jahr 2023 vor allem auch auf Kommunen in Rheinland-Pfalz zurückzuführen ist, infolge des Inkrafttretens des reformierten kommunalen Finanzausgleichs nebst Erhöhung des Nivellierungshebesatzes. Ohne diesen Sondereffekt läge die Steigerungsrate wohl weniger deutlich über den Raten der Vorjahre (+ 13 Prozent im Jahr 2022 und +8 Prozent in 2021).
Ein zentraler Aspekt, der bei der Grundsteuer-Hebesatzdebatte immer wieder vergessen wird, ist, dass es anders als zum Beispiel bei der Einkommen- (Lohnentwicklung) oder Umsatzsteuer (Inflation) keine Wertentwicklung, von Zubau mal abgesehen, bei der Steuerbasis gibt. Während infolge von Tarifverhandlungen und Inflation die Ausgaben der Kommunen konstant wachsen, erfolgt bei der Grundsteuer keine automatische Wertentwicklung. Es ist also systemimmanent, dass die Kommunen hier über Hebesatzanpassungen gegensteuern müssen. Wirkliche Zusatzeinnahmen werden mit Grundsteuerhebesatzerhöhungen in der Regel nicht generiert.
Mit Blick auf die sog. Aufkommensneutralität im Zuge der Reform der Grundsteuer, die im Übrigen auch nicht mit einer individuellen Belastungsneutralität verwechselt werden darf, gilt, dass die Städte und Gemeinden bestrebt sind, das Aufkommen aus der Grundsteuer in der Summe stabil zu halten. Wenn Städte oder Gemeinden die Grundsteuer anheben, dann nur deswegen, weil sie wegen ihrer desolaten Haushaltslage dazu schlicht gezwungen sind. Allein in diesem Jahr steuern die Kommunen in der Summe auf ein Defizit in Höhe von über -17 Mrd. Euro zu. Besserung ist für die Folgejahre nicht in Sicht. Kein Gemeinderat wünscht sich Steuermehrbelastungen in der Kommune. Dazu kommt es nur, wenn der Gemeinde kein anderer Ausweg bleibt. Land und Bund stehen in der Pflicht, für eine aufgabengerechte kommunale Finanzausstattung zu sorgen.
Die EY-Analyse kann online unter https://info.ey.com/de-ey-2024-11-21-EY-AnalyseJedevierteKommuneinDeutschlanderhhte2023dieGrundsteuer-download-form.html angefragt werden. In der Präsentation werden auch die Kommunen mit dem höchsten und niedrigsten Hebesatz in den jeweiligen Bundesländern aufgeführt.